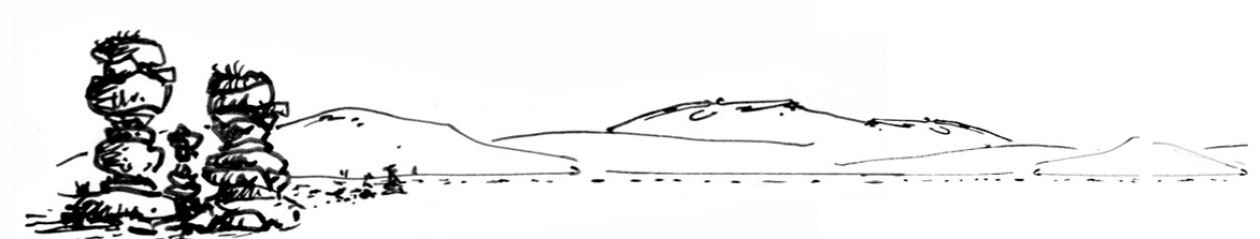Die Begleiterin, Frau Astrid Habiba Kreszmeier, Lehrthearapeutin für Einzellehrtherapie, welche die Autorin seit 20 Jahren kennt, weist in ihrer Buchempfehlung am 22. Februar 2022 darauf hin, es sei der Autorin ein Anliegen gewesen, dass es nicht lektoriert werde: „[Katalin Hepp] ist ein bemerkenswerter, eigensinniger, liebevoller, willensstarker und lebensmutiger Mensch. Dieser besonderen Mischung ist es wohl auch zu verdanken, dass sie ab dem Frühjahr 2021 neun Monate lang konsequent an ihrem Buch gearbeitet hat, ehe es im Januar 2022 tatsächlich erscheinen konnte. Das Werk wird wohl nie in den öffentlichen Handel kommen. Ebenso wird es – ausser hier – wohl kaum zitiert werden und schon gar nicht rezipiert. Dennoch scheint es mir wert, dieses Buch hier vorzustellen. Nicht weil ich einer jungen Frau mit einer seltenen, genetisch bedingten Behinderung einen Gefallen tun will, sondern weil es ein lesenswertes Buch ist, über das es sich zu sprechen lohnt. Eine Rezension also.“
Es ist in der Tat ein sehr lesenswertes Buch und erfreulicherweise kann das Buch „Mein erfundenes Leben“ mittlerweise in jeder gut sortierten Buchhandlung erworben werden.
Auf der Rückseite des Buches weist die junge Autorin Katalin Hepp darauf hin, dass sie mit dem Niikawa-Kuroki-Syndrom geboren wurde, kennt daher aus eigener Erfahrung die übliche Neigung zu Vorurteilen, so dass Sie sich aus gutem Grund zu einer Klärung genötigt sah: „Ich habe das Buch alleine geschrieben, bitte beachtet nicht die rechtschreibfheler, sondern den Inhalt“.
Bereits die Rückseite des Buches eröffnet auch jenen Lesern, welche irrtümlich und ignorant nicht dazu in der Lage sind, Oberfläche von Inhalt unterscheiden zu können, obschon eine Oberfläche nicht das Geringste über Inhalte aussagen könne, die Möglichkeit, diesen Unsinn zu erkennen und zu korrigieren.
Wird doch jenes, was wahrgenommen wird, stets auch beeinflusst davon, welche Vorstellungen einer in sich trägt. Ein Kernpunkt alltäglicher Fehlurteile ist die unbestreitbare Tatsache, dass der Mensch in der Regel nur zu gerne bereits anhand der Oberfläche urteilt, hierzu auch noch aus Ignoranz geborene unzutreffende Andichtungen heranzieht, damit völlig unfähig wird, diese angewandte Dummheit als offensichtlichen Irrtum auch nur ansatzweise zu erkennen und in Folge – darauf basierend – seine Reaktion in Form tätiger Ignoranz fortgesetzt ausrichtet.
Als Beispiel sei Frau Julia Knopf genannt, Professorin für Fachdidaktik in der Grundschule, welche in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung am 5. Februar 2020 darauf hinwies, dass vor mehr als einem Jahrhundert eine einheitliche Orthografie eingeführt worden sei, damit Texte leichter verschriftlicht und besser gelesen werden können, denn das Gehirn könne Texte, die Standards folgten, viel störungsfreier verarbeiten und es gebe Studien, die zeigen würden, dass allein fehlende Kommata das Lesetempo drastisch verringere. es daher „wahnsinnig wichtig“ sei, bei Schülerinnen und Schülern das Rechtschreibbewusstsein wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken, gestützt durch das Argument, es sei belegt, dass Arbeitgeber aus fehlerhaften Bewerbungen negative Rückschlüsse auf die Disziplin und Ausdauer des Bewerbers zögen.
Jenseits der beschränkten Urteilsfähigkeit solcher Personalchefs wäre in einem Selbsttest allerdings jederzeit die Erfahrung möglich, dass auch Texte, welche nicht der einheitlichen Orthografie folgen, vom Gehirn störungsfrei verarbeitet werden können, Sollte da einer sein, der Texte ablehnt, da diese auf eine Groß- und Kleinschreibung oder Satzzeichen verzichten, wie zum Beispiel bei Gedichten der Neuzeit gerne angewandt, möge ein solcher besser vorher sein Gehirn untersuchen lassen, bevor er über geschriebene Sätze urteilt.
Diese Fakten kennend, bittet Frau Katalin Hepp, der Leser möge nicht die Rechtschreibfehler beachten, sondern den Inhalt. Ist doch offensichtlich, dass die Professorin für Fachdidaktik in der Grundschule es versäumte, die bereits seit 1925 allseits zugängliche „Ansprache zum Schulbeginn“ von Erich Kästner zu studieren: „Früchtchen seid ihr, und Spalierobst müsst ihr werden! Aufgeweckt wart ihr bis heute, und einwecken wird man euch ab morgen! … Vom Baum des Lebens in die Konservenfabrik der Zivilisation?“.
Die junge Autorin war weise genug, sich nicht in die Konservenfabrik der Zivilisation einwecken zu lassen und lehnte es ab, zu Spalierobst zu degenerieren. Im Ergebnis legte sie Zeugnis ab, dass sich ihr Lebensbericht ohne jegliche Mühe zügig und flüssig für jedermann lesen lasse, das Gehirn völlig störungsfrei der Erzählung folgen könne und was die richtige Setzung von Satzzeichen betrifft, so bewies bereits der Autor Rúnar þór þórarinsson in seinem Buch „Enn einn dagurinn“ („An einem einzigen Tag“), dass sogar eine seitenlange Erzählung mit nur einem Komma und ohne jeglichem Punkt sehr anschaulich zu Papier gebracht und mühelos gelesen werden kann.
Katalin Hepp berichtet in ihrem Buch, dass sie in ihren Schuljahren mehr Kontakt zu ihren Lehrern und sehr wenig zu ihren Schulkameraden hatte:
„Ich habe die diagnose kabukisyndrom das wurde im jahr 1999 festgestellt und dadurch gehört auch meine Taubheit dazu habe ich durch meine behinderung eine sehr besondere seele und spüre es genau wenn es jemand nicht gut gehts oder wenn jemand traurig ist aber manchmal ärgere ich mich auch darüber dass ich leider nicht so bin wie die anderen Menschen die wo gesund sind aber es hat keinen sinn sich darüber zu ärgern weil wir alle zusamen gehören ob gesunde menschen oder kranke sonst währe es ja viel zu langweilig und somit kann sich ein bunter lebenskreis schliessen.“
Womit die Frage berechtigt, ob es sich bei dieser willkürlichen Ausgrenzung von Mitmenschen, die „nicht so sind wie die anderen gesunden Menschen“ um eine angeborene Einstellung eines neugeborenen Kindes handle, oder nicht vielmehr um das Resultat sogenannter Erziehungsberechtigter, also deren pädagogischer Einflussnahme auf die Entwicklung und das Verhalten Heranwachsender.
Nun, die Berichte von Frau Katalin Hepp belegen eindeutig, dass es sich dabei nicht um eine angeborene Einstellung eines neugeborenen Kindes handeln könne, womit der Ratschlag von Erich Kästner verständlich wird: „Liebe Eltern, wenn Sie etwas nicht verstanden haben sollten, fragen Sie Ihre Kinder.“
„Mein erfundenes Leben“
Katalin Hepp
epubli Verlag, Berlin
48 Seiten
ISBN: 9783754933145
Preis: 15,99 €
Das Buch ist auch über den Buchhandel erhältlich