Da die nächsten Tage allgemein mit dem Eigenschaftswort „besinnlich“ verknüpft werden, gewährt bekanntlich die Trollfrau Gryla auf Island alljährlich ab dem 12. Dezember ihren 13 Söhnen (Jólasveinar) Freigang, jeden Tag ein weiterer, welcher sich daraufhin unters Volk mischt:
12. Dezember Stekkjarstaur – ist vor allem an der Milch der Schafe interessiert
13. Dezember Giljagaur – er mag sehr gerne den Schaum der Kuhmilch
14. Dezember Stúfur – schätzt angebrannte Reste in einer Pfanne
15. Dezember Þvörusleikir – schleckt gerne Kochlöffel blitzblank
16. Dezember Pottasleikir – macht sich an den Resten in Kochtöpfen zu schaffen
17. Dezember Askasleikir – schätzt den Inhalt hölzener Schüsseln (Askur)
18. Dezember Hurðaskellir – schlägt am liebsten laut Türen zu
19. Dezember Skyrgámur – ist gierig nach isländischem Skyr (nicht zu verwechseln mit dem, was in Deutschland fälschlicherweise unter dem Namen „Skyr“ verkauft wird!)
20. Dezember Bjúgnakrækir – macht Jagd auf geräucherte Würste
21. Dezember Gluggagægir – glotzt gerne durch Fenster in Wohnungen (was auch gerne Passagiere einlaufender Kreuzfahrtschiffe tun)
22. Dezember Gáttaþefur – schnüffelt gerne nach frischem Weihnachtsbrot (Laufabrauð)
23. Dezember Ketkrókur – schon ist der Weihnachtsbraten futsch
24. Dezember Kertasníkir – klaut Kerzen.
Da die isländischen Kinder dies wissen, stellen sie jeden Abend während der 13 Tage ihre Schuhe auf den Fenstersims, für den Fall, dass die Trolle etwas mitbringen. Das kann gut gehen, oder auch nicht, denn die Trolle überreichen ihre Gabe in Abhängigkeit davon, ob das Kind Unsitten hat einreißen lassen oder das Jahr über gesittet handelte. Gab es Anlass zur Beanstandung, so fand das Kind am nächsten Morgen eine Kartoffel im Schuh, als Zeichen dafür, dass es bitte nächstes Jahr etwas zur Besinnung kommen möge.
Nun, der aufgeklärte Mensch der wissenschaftsbasierten Informationsgesellschaft mag dies für ein Märchen halten. Allerdings sind Isländer abwägende Menschen, und gehen lieber auf Nummer sicher, was dazu führt, dass Straßen in Ísland gelegentlich einen Bogen um einen Findling machen, denn es könnte sich ja darunter ein Tröll befinden, und deren Rache ist allgemein gefürchtet. Man weiß ja nie …
Die überwiegende Masse der aufgeklärten Menschen außerhalb von Ísland tangiert das nur peripher. Genügt diesen doch – so ist zu lesen – bereits der Glaube zu wissen, wo der Bartl den Most holt, so dass auch Halbwissen vollauf genüge, um sich sein Vorurteil bilden zu können; in der Regel auf simplen Pauschalisierungen gegründet, denn es wäre doch eindeutig zu viel verlangt, sich auch noch um eine differenzierte Betrachtungsweise bemühen zu sollen.
Und somit steht nicht zu befürchten, dass einer einen Schaden dadurch erleide, würde dem isländischen Märchen ein weiteres Märchen aus einem anderen Land hinzugefügt. Das Märchen von Oumi Khadischa.
Jenseits des Begriffs „Kulturen“, dem Plural eines heiß umworbenen, strittigen und daher undefiniertem Singulars, den irgendwelche Dumpfbacken 1996 zum Anlass nahmen, von einem „Kampf der Kulturen“ (The Clash of Civilisations) zu faseln, um sich als hilfreiche „Weltpolizei“ aufspielen zu dürfen, wäre schon viel gewonnen, sollte einem Leser im Bedarfsfalle auch noch dämmern, dass der Plural von „Kultur“ und allem, was damit aus niedrigen Beweggründen heraus kolportiert wird, nur grober Unfug sein kann. Was da bisweilen mit dem Plural „Kulturen“ kolportiert wird, erfüllt noch nicht einmal die Mindestanforderungen an eine „Zivilisation“, da eine solche zwischen „Zivilisation“ und „Sitte / Brauch“ zu unterscheiden wüsste, wie zum Beispiel das isländische Wort „menning“ (Kultur) belegt, welchem im Kontrast hierzu signifikante Benennungen gegenüberstehen: háttur, lenska, siður (Brauch/Sitte), siðvenja (Tradition), vani (Angewohnheit, Gepflogenheit, Gewohnheit) und venja (Praxis).
Oumi Khadischa war die Urenkelin jener Frau, zu deren Ehren zwischen Menzel Bourguiba und Mateur auf einem Hügel ein Marabout errichtet wurde, welcher ihren Leichnam birgt. Zu diesem Marabout führen genau 100 Stufen und jede Stufe hatte eine gewisse Bedeutung. Unten, neben der ersten Stufe, war ihr Ehemann bestattet. Nun, dies ist weder eine Herabwürdigung noch eine Geringschätzung. Verhält es sich doch so, dass in jener Gemeinschaft, welche das Marabout für Oumi Khadischas Urgroßmutter errichtete, die Frau der Herr im Haus ist und der Ehemann nur Gast. So darf der Ehemann in jener Gemeinschaft nur jemanden in das Haus einladen, wenn er vorher seine Ehefrau gefragt und diese es gestattet habe. Seine Ehefrau hingegen kann einladen wen immer sie will, ohne ihren Ehemann fragen zu müssen. Ist dem Ehemann der Gast nicht willkommen, so verweist ihn die Ehefrau auf seine Möglichkeit, die ihm frei stehe und niemand übel nehmen werde: Das Haus hat zwei Türen.
Es handelt sich demnach nur um die Fortsetzung dieser Regel über den Tod hinaus, ist doch das Marabout das Haus von Oumi Khadischas Urgroßmutter, welches auch oft von zahllosen Leuten aufgesucht wird und diese auch alle stets willkommen sind, da diese sich spirituellen Beistand erbitten. Allerdings könnte der Ehemann nicht mehr die Möglichkeit der zwei Türen nutzen, sollte ihm ein Besucher missfallen.
Zu Lebzeiten war es für beide viel einfacher. Er ging außer Haus und kam nach der Verabschiedung des Gastes wieder zurück. Sollte der Besucher hingegen unerwartet vor der Tür stehen und als Gast für beide Ehepartner nicht willkommen sein, so verbietet es die gute Sitte, den Besucher abzuweisen. Der Besucher wird folglich freundlich hereingebeten und erhält wie jeder Gast zuerst einen arabischen Kaffee, bevor der Plausch beginnt.
Kaffee ist bekanntlich jenes Getränk, welches die Eigenschaft besitzt, den Blutkreislauf etwas anzuregen, womit das Gehirn etwas besser durchblutet wird, was geeignet ist, die geistigen Fähigkeiten zu fördern. Einst aus Äthiopien von Karawanen durch die Wüste in den Norden transportiert, trat der Kaffee seinen Siegeszug in die ganze Welt an, von den arabischen Ländern über die Türkei nach Wien, um dann in Folge – vom Wiener Cafe ausgehend – in so seltsamen Establishments jämmerlich und geschmacklos zu verenden, welche so unverständliche Namen wie zum Beispiel “Starbucks” tragen.
Dieser Brauch, bei arabischem Kaffee zu plauschen, eröffnet den beiden Ehepartnern die Möglichkeit, dem Besucher nonverbal mitzuteilen, dass er hier in diesem Haus unerwünscht sei. Verhält es sich doch so, dass in arabischen Ländern der Kaffee aromatisiert getrunken wird, somit nicht nur Kaffee und Zucker in das Wasser gegeben wird, sondern auch Kardamom, Rosenwasser, etc., je nach Gusto. Wird allerdings ein ungebetener Gast bewirtet, so kommen die Aromen bei der Zubereitung des Kaffees nicht in den Kaffeepott, sondern in die Tassen, mit Ausnahme jener Tasse selbstverständlich, welche der Besucher bekommt. Ist der Besucher intelligent, wird er von weiteren Besuchen Abstand nehmen. Böse Zungen behaupten, dass dies die Ursache sei, warum der Kaffee in arabischen Ländern aromatisiert getrunken wird und in der Türkei nur als Mokka.
Doch nicht nur die Aromen ermöglichen bei Zusammenkünften eine nonverbale Kommunikation. Begibt sich zum Beispiel ein junger Mann auf Brautschau, so ist es gute Sitte, dass der junge Mann mit seinem Vater um die Hand der Tochter bei deren Vater anhält, denn es gebietet der Respekt, dass entscheidende Unterhaltungen auf Augenhöhe stattfinden, also zwischen einer Generation, und nicht zwischen einer Generation und einer nachgekommenen Generation. Der Plausch beginnt mit dies und das, denn es gilt als unfreundlich, gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Dies gibt der Angebeteten die Möglichkeit, den arabischen Kaffee zuzubereiten. Was tut diese? Sie entscheidet, ob der Zucker in den Kaffeepott kommt, oder in die Tassen. Möchte sie den Antrag des jungen Mannes annehmen, so kocht sie den Kaffee mit Zucker, lehnt sie den Antrag des jungen Mannes ab, so kommt der Zucker in die Tassen, allerdings nicht in die Tasse des jungen Mannes. Ist der Bursche intelligent genug, dann signalisiert er seinem Vater, dass er noch einen anderen wichtigen Termin habe, womit die Väter den Plausch ausklingen lassen und sich voneinander verabschieden. Ist jedoch der Kaffee des Burschen gesüßt, signalisiert er seinem Vater, dass seine Angebetete den Antrag annehmen werde. Die Besprechung der Hochzeit kann beginnen.
Allerdings stürzt sich damit der junge Mann in erhebliche Schulden, muss er doch vor der Hochzeit das Brautgeld in Gold bei seiner Angebeteten abgeben. Menschen, bei denen das Maul größer ist als das Wissen, erzählen gerne, es würde die Braut damit verkauft wie Kamele und das Gold von den Eltern der Braut vereinnahmt. Sie verkünden damit nur ihr Unwissen, denn tatsächlich verhält es sich bei jener Gemeinschaft so, dass das Gold tatsächlich die Braut erhält, es ihr ungeteiltes Eigentum bis an ihr Lebensende bleibt, denn es handelt sich bei dem Gold um die Absicherung der Ehefrau für jenen Fall, bei dem sich der Bursche später als wankelmütiger Geselle herausstellt, sich woanders herumtreibt statt wie versprochen bei seiner Ehefrau, demnach um den vorgezogenen Scheidungsunterhalt. Dieses Gold gehört der Frau allein und ist niemals Gegenstand einer Erbschaft. Die Frau selbst ruft später, bevor sie stirbt, am Krankenbett die Begünstigten nach ihrer Wahl zu sich und gibt jedem Gerufenen nach eigenem Gutdünken einen Teil des Goldes.
Da es sich in diesem Land allerdings so verhält, dass die jungen Menschen nicht so vermögend sind oder sogar arbeitslos, damit den jungen Burschen ein großes Unrecht zugefügt wird, da sie somit nicht heiraten können, andererseits der Angebeteten großes Unrecht zugefügt wäre, müsste sie auf ihre Absicherung verzichten, traf Oumi Khadischas Urgroßmutter eine Entscheidung, welche seitdem gute Sitte in jener Gemeinschaft ist. Sollte die Braut auf das Gold selbst verzichten wollen, steht es ihr frei, bei allen Familienangehörigen um kleine Münzen zu bitten, bis sie 69 Miilimes eingesammelt hat. Diese übergibt sie dann ihrem zukünftigen Ehemann, auf dass er die 69 Millimes ihr öffentlich als sein Brautgeld überreichen könne. In diesem Fall ist jeder Familienangehörige dazu verpflichtet, die Hochzeit zu billigen und kraftvoll zu unterstützen.
Oumi Khadischa war es immer eine Lust, in Pariser Geschäften den für sie passenden Schal auszusuchen; modisch genug hatte er zu sein, um ihre Weltoffenheit preiszugeben, jedoch in Farben gehalten, die ihrer tiefen Verbundenheit mit der Natur nicht widersprachen. In seiner Aufmachung und Ornamentik war dabei auf den Status ihres Stammes genauso zu achten, wie auf die Stellung, die sie innehatte. Seit sie den Titel Hajji sich erwarb, bevorzugte sie als Zeichen ihrer Würde nur noch jenen weißen Schal, der nur einer Hajji zustand.
Eines Tages, sie wollte nach ein paar Jahren wieder Europa besuchen, bat sie darum, ihr die für Besuche in Deutschland erforderliche Bürgschaftserklärung zuzusenden, da sie noch einmal reisen möchte, um die neuen Enkelkinder zu sehen, bevor sie sterbe.
Im Zuge von 9/11 hatte jedoch das deutsche Auswärtige Amt mit der tunesischen Regierung vereinbart, dass Tunesier, die ein Touristenvisa bei der deutschen Botschaft in Tunis beantragen, nun persönlich in der dortigen Visa-Abteilung zu erscheinen hätten, ungeachtet des Alters der Person, und selbst ihre Papiere vorzulegen haben. Weibliche Besucher dürften dabei im Gegensatz zu früherer Praxis die deutsche Botschaft nur noch ohne Kopfbedeckung betreten.
So machte sich Oumi Khadischa , schon von ihrer schweren Krankheit gezeichnet, notgedrungen selbst auf den Weg nach Tunis, um sich in die Schlange der Antragssteller einzureihen, die bereits lange vor Sonnenaufgang vor dem Eingang der deutschen Visa-Abteilung ausharrten, um innerhalb der Öffnungszeiten noch ihren Antrag einreichen zu können, und nicht nach vergeblichem stundenlangen Warten vor dann verschlossenen Türen unverrichteter Dinge wieder heimkehren zu müssen.
Als sie nach mehreren Stunden endlich an dem vor dem Eingang wachhabenden Polizeibeamten stand, forderte dieser sie weisungsgemäß auf, ihren Schal abzulegen, da das Betreten der Visa-Abteilung nur ohne Kopfbedeckung erlaubt sei. Oumi Khadischa fragte ihn, ob er denn wisse, mit wem er da spreche, und ob man ihm als Kind nicht den Respekt beigebracht hätte, den man alten Frauen schuldig sei. Das brachte den jungen Polizeibeamten in arge Verlegenheit, war er doch nur ein junger Bursche, sie hingegen eine alte Frau, noch dazu eine Hajji, welcher er damit bereits aus zwei Gründen Respekt entgegenzubringen hatte; auch erregte der Disput bereits die Aufmerksamkeit der umstehenden Neugierigen.
In seiner Not erklärte er Oumi Khadischa , dass er seinen Job verlieren würde, sollte er sie mit dem Schal in die deutsche Botschaft lassen. Da nahm sie plötzlich den Schal ab, drückte diesen dem jungen Burschen in die Hand, und trug ihm auf, ihren Schal solange in Sicherheitsverwahrung zu nehmen, auf ihn sorgfältig aufzupassen und ihn ja nicht aus den Händen zu geben, bis sie aus der deutschen Botschaft zurückgekehrt sei.
Ließ den jungen Mann mit hochrotem Kopf zurück, auf das Peinlichste vor allen Umstehenden bloßgestellt; ein stattlicher junger Kerl in Uniform, der Öffentlichkeit preisgegeben, ausgerechnet mit einem Damenschal in seiner Hand, noch dazu mit einem Schal einer Hajji, als respektabler Polizist, als Respektsperson, nun von allen Wartenden grinsend begafft.
Als Oumi Khadischa aus der Visa-Abteilung zurückkehrte, nahm sie ihren Schal wieder an sich, und fragte den Polizisten, ob er nicht genug Anstand hätte, da er sich bei ihr nicht bedanke; um dann dem Beamten, der nur verblüfft und fragend in seiner offensichtlichen Betretenheit die alte Frau anstarrte, zu erklären, dass sie ihm immerhin gerade seinen Arbeitsplatz gerettet habe.
Sagte es, und verschwand in der wartenden Menge; durch die weite Gasse, die ihr die Wartenden respektvoll anboten.
Verhält es sich doch so, dass der Polizist wie alle Menschen eine abhängige Kreatur ist, wozu ihm also zusätzliches und unnötiges Leid bescheren.
In diesem Sinne wünschen wir allen Lesern besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
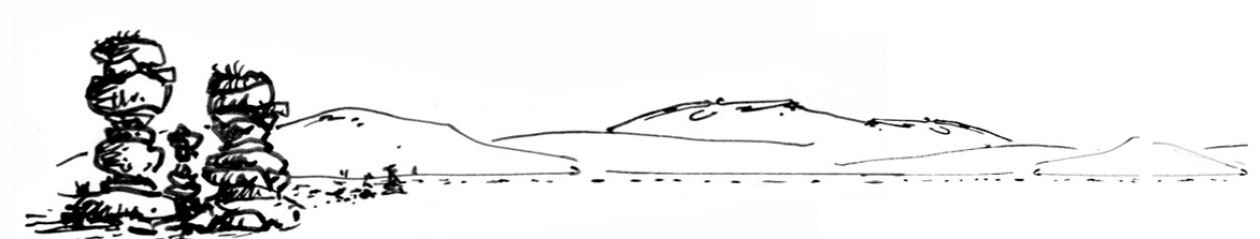

Gleðileg jól!