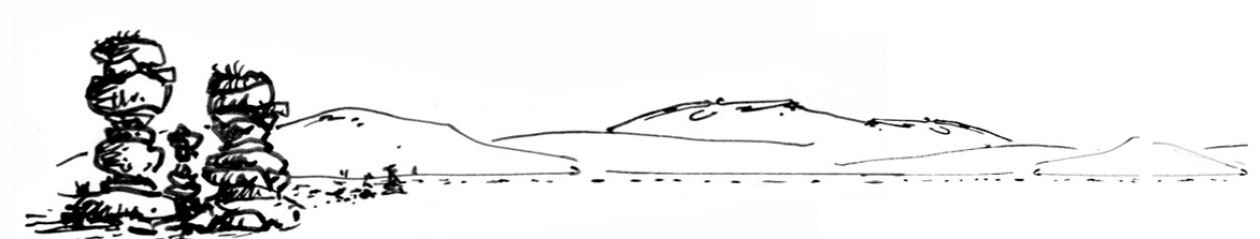Ónytjungur: „Na, ist deine Arbeit endlich erledigt?“
Jólasveinn: „Alles im grünen Bereich. Dankenswerterweise gibt es diesen Brauch nur hierzulande und nicht anderenorts.“
Ónytjungur: „Wieso? Hast du alle Kartoffeln bereits hier verbraucht?“
Jólasveinn: „Keineswegs, aber anderenorts hätte eine Kartoffel im Schuh nicht gereicht, ich hätte einen ganzen Sack Kartoffeln darin deponieren müssen. Das wäre mir zu beschwerlich gewesen bei meinem Rücken.“
Ónytjungur: „Nun ja, vermutlich wären die Schuhe herfür auch viel zu klein gewesen. Aber aus welchem Grund gleich einen Sack voll Kartoffeln? Hier genügt doch auch bereits eine einzige Kartoffel.“
Jólasveinn: „Wie du weißt, legen die Leute hier größten Wert auf eine präzise Sprache. schätzen gute Literatur über alles, erhalten sogar Philosophieunterricht an Grundschulen, sind sehr gebildet und haben daher ihre Politiker gut erzogen …“
Ónytjungur: „… und sollten die Politiker dennoch einmal aus dem Ruder laufen, werden sie solange mit dem Lärm von Topfdeckeln und Pfannen malträtiert, bis diese freiwillig die Flucht ergreifen, alles bekannt …“
Jólasveinn: „… und Betrüger schleunigst das Land verlassen …“
Ónytjungur: „… auch das ist bekannt, sie gehen freiwillig in die Verbannung …“
Jólasveinn: „… und für den Fall, wie wollten sich wieder heimlich ins Land schleichen, werden deren Konterfeis in die Männer-Pissoirs geklebt, damit sie ein jeder sofort erkenne. Allerdings sind solche guten Sitten nicht in allen Ländern üblich, dort liegt es daher sehr im Argen.“
Ónytjungur: „Ich staune und hoffe, du schilderst es mir auf eine Art und Weise, so dass auch ich es verstehen könnte.“
Jólasveinn: „Was würdest du zum Beispiel von einem Wissenschaftler halten, der dir allen Ernstes vorschlägt, dein Knie operieren zu wollen, da dies dich davor schützen würde, dass du Windpocken bekommst und damit andere ansteckst, später dir erklärt, dies würde allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum Abhilfe schaffen, um dann noch nachzuschieben, diese würde allerdings auch nicht verhindern, dass du andere mit Windpocken anstecken könntest?“
Ónytjungur: „Dass es sich dabei wohl um einen Versicherungsvertreter handeln müsse, denn die versprechen einem auch gerne das Blaue vom Himmel vor Vertragsabschluss.“
Jólasveinn: „Was würdest du ferner von Politikern halten, denen in dem Moment, in welchem das Staatsvolk dringend der Hilfe bedarf, ihre Machtposition dahingehend nutzen, durch geschickte Geschäfte Millionenbeträge der stattlichen Hilfe sich selbst zuzuschustern?“
Ónytjungur: „Gibt es dort keine Strafgesetze?“
Jólasveinn: „Was würdest du von Behörden halten, welche Jahre zu der Feststellung benötigen, ob ein Produkt, welches vor Erkrankung schützen soll, überhaupt schützt, oder es sich dabei nicht vielmehr um ein wertloses Produkt handelt, welches zwar teuer eingekauft, allerdings nur vorgibt, dass es schützen würde, dies jedoch wissentlich nicht tut?“
Ónytjungur: „Gibt es dort auch kein bürgerliches Gesetzbuch, welches den Geschädigten ermögliche, umgehend Schadensersatzforderungen einzutreiben?“
Jólasveinn: „Du weißt ja, es gibt dort kein Recht, kein Gesetz, nur Schriftsätze. Zu guter Letzt, was würdest du von Medien halten, welche anstelle investigativer Recherche es lieber vorziehen, tagein, tagaus mit gefälligen Fragen einem ausgewählten Kreis von Selbstdarstellern eine Bühne zu bereiten?“
Ónytjungur: „Darf ich raten? Die amerikanische Schwatzbude namens ‘Talk-Show’“?“
Jólasveinn: „Ich frage dich allen Ernstes: Würde bei all jenen eine einzige Kartoffel reichen?“
Ónytjungur: „Nun, das Staatsvolk wird diesen sicherlich wie hier üblich sehr schnell zeigen, wo der Bartl seinen Most holt.““
Jólasveinn: „Du vergisst, sie entbehren dort der hier üblichen Erziehung und Bildung, welche zu Selbstverantwortung und Freiheit führt.“
Ónytjungur: „Möglicherweise ist die Ursache in der Staatsform zu finden.“
Jólasveinn: „Ob Diktatur, Monarchie, mittelbarer Mehrheitsentscheid, sie unterscheiden sich darin keinen Deut. Auffallend ist, dass sich allesamt vor Jahrhunderten einem Schichtenmodell unterwarfen, an dessen Spitze ein Führer thronte, der par ordre du mufti befahl – sei dieser Führer nun klerikal, weltlich oder gleich beides -, darunter lag eine privilegierte Schicht aus Speichelleckern oder Aufmüpfigen, allgemein als Aristokratie bezeichnet, als Bestherrschaft angesehen, schließlich die abhängigen Kreaturen der letzten Schicht, die jeglichen Rechts beraubt.“
Ónytjungur: „Was kam deiner Ansicht nach dabei heraus?“
Jólasveinn: „Eine Melange aus sechs Typen. Da wäre zum Beispiel der gehorsame Typ.“
Ónytjungur: „Du meinst jenen, der zu allem Ja und Amen sagt, ohne dass ihm daraus ein Zweifel erwachse?“
Jólasveinn: „Es gäbe da auch noch den duldenden Typ.“
Ónytjungur: „Er sagt zwar zu allem Ja und Amen, obschon er still darunter leidet?“
Jólasveinn: „Nun, es gibt auch den ablehnenden Typ.“
Ónytjungur: „Er widerspricht, lässt aber Unbeteiligte unbehelligt?“
Jólasveinn: „Ganz im Gegensatz zum beschuldigenden Typ.“
Ónytjungur: „Der zwar nicht widerspricht, allerdings Unbeteiligte beschuldigt.“
Jólasveinn: „Das Schlusslicht bildet der gehirnlose Typ.“
Ónytjungur: „Aha, er weigert sich also und beschuldigt Unbeteiligte.“
Jólasveinn: „Den autarken Typ, der dort unten im Tal die Mehrzahl stellt, findest du dort nur noch selten, wegkonditioniert durch Jahrhunderte währende bittere Erfahrung am eigenen Körper.“
Ónytjungur: „Du zeichnest ein düsteres Bild, mein Freund.“
Jólasveinn: „Nun, es wurden ihnen Wege aufgezeigt, um sich darin zurechtzufinden.““
Ónytjungur: „Als da wären?“
Jólasveinn: „Zwei amerikanische Wissenschaftler, die Sozialpsychologen David Dunning und Justin Kruger, beruhigten im Jahr 1999 die händeringend nach einem Ausweg suchende wissenschaftsbasierte Informationsgesellschaft im ‚Journal of Personality and Social Psychology‘ mit einem Artikel, demzufolge jeder der gegnerischen Seite zurecht vorwerfen könne, diese sei nicht nur inkompetent, sondern auch aus Dunning-Kruger-Gründen außerstande, dies einzusehen.“
Ónytjungur: „Verhält es sich nicht vielmehr so, dass selbst das zurückhaltende Ergebnis aus der Originalveröffentlichung mittlerweile widerlegt wurde? Das Experiment sei zwar reproduzierbar und der Effekt trete tatsächlich auf, er ließe sich allerdings auch dann hervorrufen, falls man das Experiment weglässt und die Ergebnisgrafik aus Zufallszahlen erzeuge, denn in Wirklichkeit kann niemand die eigene Kompetenz korrekt einschätzen.“
Jólasveinn: „Jæja, gamli minn. Das erinnert mich an jenes Ereignis, als ein Mensch in seiner Badewanne saß und das Telefon klingelte. Der Mann stand also auf, eilte zum Telefon, nahm den Hörer ab und hörte die Stimme eines Mannes.“
Ónytjungur: „Und weiter?“
Jólasveinn: „Die Stimme am Telefon teilte mit, er führe gerade eine Meinungsumfrage durch und seine erste Frage an den Angerufenen im tropfenden Bademantel wäre, ob dieser wegen einer Meinungsumfrage aus seiner Badewanne steigen würde.“
Ónytjungur: „Ist es nicht seltsam, dass je mehr einer das Ursache-Wirkungs-Prinzip abstreitet, also die Kausalität, umso mehr er in Korrelationen sein Heil sucht?“
Jólasveinn: „Wen wundert es dann noch, dass sie sich darüber laufend in Widersprüche verstricken? Magst du ein Lied mit mir singen?“
Ónytjungur fasste Jólasveinn bei der Hand und beide tanzten einen Reigen auf dem Stein:
„Seitdem man begonnen hat,
die einfachsten Behauptungen
zu beweisen, erweisen sich viele
von ihnen als falsch.
Manche Menschen würden eher
sterben als nachdenken.
Und sie tun es auch.“ 1)
1) Bertrand Russell